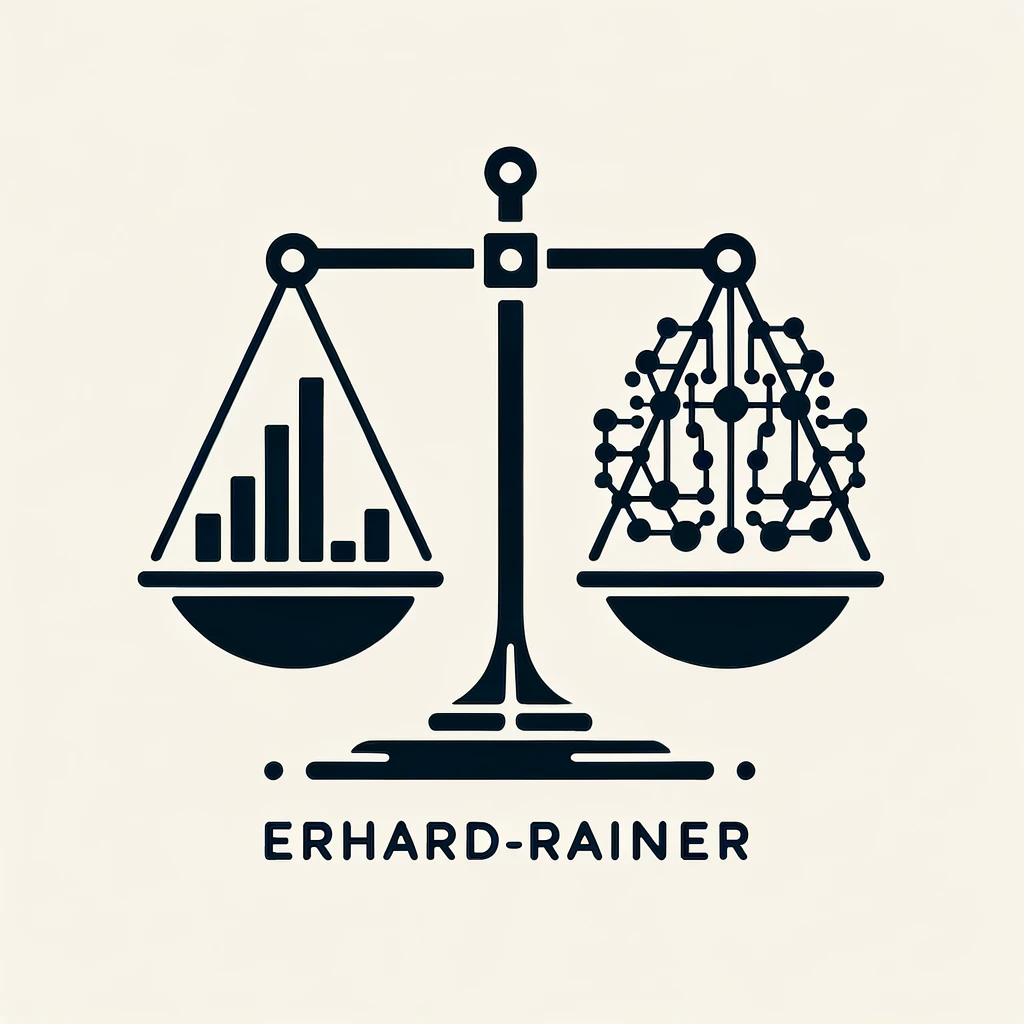1. Was ist funktionale Partitionierung?
Die funktionale Partitionierung ist eine Strategie zur Organisation von Daten in Datenbanksystemen, bei der Daten basierend auf ihrer funktionalen Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Geschäftsbereichen oder -prozessen in separate Tabellen oder Datenbanken aufgeteilt werden. Im Gegensatz zur technischen Partitionierung, die sich auf die physische oder logische Aufteilung von Daten innerhalb einer Tabelle bezieht (z. B. horizontale oder vertikale Partitionierung), erfolgt die funktionale Partitionierung auf einer höheren Abstraktionsebene.
Ziel der funktionalen Partitionierung ist es, die Modularität, Wartbarkeit und Skalierbarkeit des Systems zu verbessern, indem Daten, die unterschiedlichen Funktionen oder Modulen innerhalb eines Unternehmens zugeordnet sind, getrennt verwaltet werden. Dies ermöglicht eine klarere Trennung der Verantwortlichkeiten und kann die Performance optimieren, insbesondere in komplexen oder verteilten Systemen.
2. Abgrenzung zur Normalisierung
Obwohl sowohl die funktionale Partitionierung als auch die Normalisierung zur Strukturierung von Daten beitragen, verfolgen sie unterschiedliche Ziele und Methoden:
- Normalisierung:
- Ziel: Vermeidung von Datenredundanz und Anomalien durch Aufteilung von Daten in mehrere Tabellen basierend auf funktionalen Abhängigkeiten.
- Methodik: Anwendung von Normalformen (1NF bis 5NF), um sicherzustellen, dass jede Tabelle eine spezifische Informationseinheit repräsentiert.
- Ergebnis: Logische Strukturierung der Daten innerhalb eines Datenbankschemas.
- Funktionale Partitionierung:
- Ziel: Trennung von Daten nach ihrer funktionalen Zugehörigkeit zu verschiedenen Geschäftsbereichen oder -prozessen.
- Methodik: Aufteilung von Daten in separate Tabellen oder Datenbanken basierend auf organisatorischen oder funktionalen Kriterien.
- Ergebnis: Verbesserung der Modularität und Skalierbarkeit durch organisatorische Trennung der Daten.
Während die Normalisierung sich auf die logische Struktur innerhalb eines Datenbankschemas konzentriert, betrachtet die funktionale Partitionierung die organisatorische Struktur über verschiedene Module oder Systeme hinweg. In vielen Fällen führt die Anwendung von Normalformen bereits zu einer Trennung der Daten in verschiedene Tabellen, die unterschiedlichen funktionalen Bereichen entsprechen. Allerdings geht die funktionale Partitionierung oft über die durch Normalisierung erreichte Struktur hinaus, insbesondere in komplexen oder verteilten Systemen.
3. Praxisbeispiele
Beispiel 1: Wenn Normalisierung nicht ausreicht
Ein Unternehmen betreibt sowohl stationären Einzelhandel als auch einen Online-Shop. Die Produktdaten für beide Kanäle unterscheiden sich erheblich:
- Einzelhandel:
- Produkte enthalten Informationen zu Regalplatzierung, Lagerbestand pro Filiale, Filialaktionen.
- Online-Shop:
- Produkte enthalten SEO-relevante Informationen, Online-Bewertungen, Mediendateien (z. B. Produktvideos).
Obwohl beide Vertriebskanäle dieselben Produkte verkaufen, ist eine gemeinsame Produkttabelle problematisch: Viele Spalten wären entweder leer oder würden sich semantisch überlappen. Eine reine Normalisierung würde hier nicht genügen, da die Nutzungskontexte zu unterschiedlich sind. Eine funktionale Partitionierung in Product_Store und Product_Online wäre sinnvoller, um den jeweiligen Kontexten gerecht zu werden.
Beispiel 2: Faktentabellen nach Produktgruppen
Ein typischer Anwendungsfall ist die Aufteilung einer zentralen Faktentabelle, wie FACT_Sales, in mehrere spezialisierte Tabellen basierend auf Produktgruppen: FACT_Sales_Electronics, FACT_Sales_Furniture, FACT_Sales_Clothing usw.
Diese Struktur bietet folgende Vorteile:
- Spezifische Attribute pro Produktgruppe: Unterschiedliche Spalten je Produktgruppe sind möglich, ohne mit NULL-Werten zu arbeiten.
- Optimierte Abfragen: Analysen können gezielt auf die jeweilige Tabelle zugreifen.
- Modularität und Wartbarkeit: Tabellen lassen sich getrennt laden, archivieren oder sichern.
Herausforderung – übergreifende Analysen?
Ein oft genanntes Gegenargument ist die potenzielle Komplexität bei abteilungs- oder gruppenübergreifenden Analysen. Doch dieses Argument relativiert sich, wenn beim Design auf Konsistenz geachtet wird:
- Gemeinsame Spalten (z. B.
SaleDate,ProductID,Amount) haben gleiche Namen und Datentypen. - Eine konsolidierte Sicht kann einfach über
UNION ALLerzeugt werden:
SELECT ProductID, SaleDate, Amount FROM FACT_Sales_Electronics
UNION ALL
SELECT ProductID, SaleDate, Amount FROM FACT_Sales_Furniture
UNION ALL
SELECT ProductID, SaleDate, Amount FROM FACT_Sales_Clothing;- Bei unterschiedlichen Attributen lassen sich optionale Spalten mit
NULL AS Zusatzspaltevereinheitlichen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, diese funktionale Partitionierung mit einer vertikalen Partitionierung zu kombinieren: So könnten z. B. alle Basisfelder, die jeder FACT_Sales_*-Tabelle gemeinsam sind, in einer separaten Tabelle wie FACT_Sales_Electronics_Basis abgelegt werden, während die erweiterten, gruppenspezifischen Felder in einer ergänzenden Tabelle FACT_Sales_Electronics_Extended landen. Beide Tabellen wären über einen Schlüssel wie SalesID oder TransactionID miteinander verknüpft.
Das bringt mehrere Vorteile:
- Die
Basis-Tabelle kann inUNION ALL-Sichten gemeinsam verarbeitet werden, während dieExtended-Tabellen nur bei Bedarf gejoint werden. - Performancevorteile bei lesenden Zugriffen auf gemeinsam genutzte Spalten.
- Klarere Trennung von Kern- und Spezialinformationen.
Diese Technik erlaubt eine flexible und wartbare Datenstruktur, die sowohl analytische Performance als auch organisatorische Trennung ermöglicht.
Abgrenzung von funktionaler Partitionierung und horizontaler Partitionierung und vertikaler Partitionierung
Die Begriffe funktionale, horizontale und vertikale Partitionierung werden oft im selben Kontext genannt, unterscheiden sich aber in Ziel und Ausprägung deutlich:
- Horizontale Partitionierung: Aufteilung der Zeilen einer Tabelle basierend auf einem Kriterium, z. B. Zeit, Region oder Produktgruppe. Alle Partitionen haben dieselbe Struktur.
- Vertikale Partitionierung: Aufteilung der Spalten einer Tabelle in mehrere Tabellen, z. B. eine Basistabelle mit oft benötigten Feldern und eine Erweiterungstabelle mit seltener genutzten Attributen.
- Funktionale Partitionierung: Aufteilung der Daten basierend auf ihrer Nutzung oder Zugehörigkeit zu einem funktionalen Kontext (z. B. Online vs. Offline, Produktgruppen, Mandanten).
Interessant ist: Die Aufteilung in z. B. FACT_Sales_Electronics, FACT_Sales_Furniture ist technisch gesehen bereits eine horizontale Partitionierung, da die Zeilen anhand eines inhaltlichen Kriteriums (Produktgruppe) getrennt werden. Da sich aber die Nutzungskontexte häufig stark unterscheiden und evtl. auch die Spaltenstrukturen abweichen, handelt es sich gleichzeitig um eine funktionale Partitionierung.
Diese könnte durch eine vertikale Partitionierung zusätzlich verfeinert werden: Gemeinsame Spalten wandern in eine *_Basis-Tabelle, spezifische Spalten in eine *_Extended. Dadurch lässt sich der Datenzugriff vereinfachen, denn viele Auswertungen benötigen nur die Basisinformationen. Die Joins auf die Extended-Tabellen werden nur dann durchgeführt, wenn sie wirklich gebraucht werden. Das erhöht Übersichtlichkeit, reduziert Speicherlast und verbessert die Abfrageperformance.
4. Fazit
Die funktionale Partitionierung bietet eine effektive Möglichkeit, Daten basierend auf ihrer funktionalen Zugehörigkeit zu organisieren, insbesondere in komplexen Systemen mit unterschiedlichen Geschäftsbereichen oder -prozessen. Während die Normalisierung sich auf die logische Struktur innerhalb eines Datenbankschemas konzentriert, ermöglicht die funktionale Partitionierung eine organisatorische Trennung der Daten, die zu einer verbesserten Modularität, Wartbarkeit und Skalierbarkeit führt.
In der Praxis ergänzen sich beide Ansätze: Die Normalisierung sorgt für eine saubere und redundanzfreie Datenstruktur, während die funktionale Partitionierung die Daten entsprechend den funktionalen Anforderungen des Unternehmens organisiert. Eine durchdachte Kombination beider Methoden führt zu robusten und effizienten Datenbanksystemen.